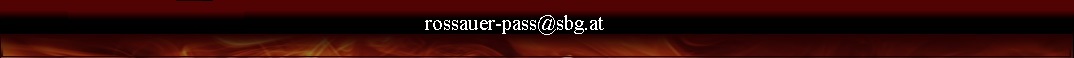Die Brauchtümer unserer Region
Es kommt der Nikolaus
In Begleitung von Krampussen (wenn gewünscht auch ohne), kommt der Nikolaus auch zu Ihnen nach Hause.
Jeder Hausbesuch dauert zwischen 15 und 20 Minuten. Je nach Anzahl der zu beschenkenden Kinder kann es auch ein wenig länger dauern.
Für das Goldene Buch braucht der Nikolaus von jedem Kind jeweils 2-3 gute und weniger gute Sachen (bitte keine die das Kind beschämen!).
Wir bitten die Eltern direkt über die unten stehende Mailadresse mit uns in Verbindung zu treten oder ab 19 Uhr ist auch ein Anruf möglich.
Sobald wir Ihre Mail haben werden wir mit Ihnen in Kontakt treten und alles weitere (Datum usw.) besprechen.
Wir freuen uns schon, Sie und Ihr(e) Kind(er) besuchen zu dürfen!
Die Geschichte des Nikolaus
Nikolaus von Myra (* zwischen 270 und 286 in Patara; † 6. Dezember 326, 345, 351 oder 365), dessen griech. Name "Sieg(reich)er des Volkes" bedeutet, ist einer der populärsten katholischen Heiligen. Sein Gedenktag, der 6. Dezember, wird in zahlreichen christlichen Glaubensgemeinschaften als kirchlicher Feiertag begangen.
Nikolaus wirkte in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts als Bischof von Myra in der kleinasiatischen Region Lykien damals Teil des Römischen, später des Byzantinischen Reichs.
Über das Leben des historischen Nikolaus gibt es nur wenige belegte Tatsachen. Myra in Lykien, heute Demre, ist ein kleiner Ort etwa 100 km südwestlich von Antalya in der heutigen Türkei. Im 4. Jahrhundert war der Ort Bischofssitz. Quellen über Nikolaus’ Leben stammen z. B. von Andreas von Kreta (um 700) und von einem Mönch Johannes aus dem Studitenkloster in Konstantinopel, das im 5. Jahrhundert gegründet wurde. Nach übereinstimmenden Überlieferungen wurde Nikolaus zwischen 270 und 286 in Patara geboren, einer Stadt in Lykien. Er sei mit 19 Jahren von seinem Onkel, ebenfalls mit Namen Nikolaus und Bischof von Myra, zum Priester geweiht worden und sei dann Abt des Klosters Sion in der Nähe von Myra gewesen. Während der Christenverfolgung 310 soll er gefangen genommen und gefoltert worden sein. Als Sohn reicher Eltern soll er sein ererbtes Vermögen unter den Armen verteilt haben (was auch von den besser bezeugten Bischöfen des 4. Jahrhunderts Ambrosius von Mailand und Basilius von Caesarea berichtet wird und dort als historische Tatsache gilt). Im Fall von Nikolaus ranken sich darum verschiedene Legenden.
Andreas von Kreta und Johannes vom Studitenkloster berichten, Nikolaus habe am Konzil von Nizäa teilgenommen und dort seinen Widersacher Arius geohrfeigt. Deshalb sei er zuerst verhaftet, gegen Ende des Konzils aber rehabilitiert worden. Nikolaus steht nicht in der Unterzeichner-Liste von Nizäa, die allerdings unvollständig überliefert ist. Andererseits gehört Bischof Theognis von Nizäa, den Nikolaus laut Andreas beim Konzil von der katholischen Sichtweise überzeugt haben soll, zu den historisch belegten Unterzeichnern. Falls Nikolaus in der Tat am nizänischen Konzil teilnahm, so ist es auf Grund der oben erwähnten Legenden und der geographischen Nähe seiner Bischofsstadt Myra zur Stadt Ancyra wahrscheinlich, dass Bischof Nikolaus die gleiche Ein-Hypostasen-Theologie vertrat wie Bischof Markell von Ankyra. Dieser wurde 336 als Ketzer verdammt und seine Lehre von den östlichen Bischöfen des Römischen Reiches als heterodox eingestuft.
Nach der Evakuierung der Stadt und vor ihrer Eroberung durch seldschukische Truppen 1087 raubten süditalienische Kaufleute die angeblichen Gebeine aus der Grabstätte des Heiligen, indem sie den Sarkophag aufbrachen, und überführten die Reliquien ins heimatliche Bari. Dort wird sein Fest am Tag der Ankunft ihrer Schiffe, dem 9. Mai, gefeiert. Die Gebeine werden in der Basilika von San Nicola aufgebahrt. Von Bari fordert die türkische Nikolaus-Stiftung die Reliquien des Heiligen der Christenheit bis heute zurück.
Die Geschichte des Krampus
Während der Nikolaus die braven Kinder beschenkt werden die unartigen vom Krampus bestraft. Der Krampus ähnelt somit in etwa dem "Knecht Ruprecht", es bestehen aber Unterschiede zwischen den beiden Figuren.
Während "Knecht Ruprecht" einzeln auftritt, treten die Krampusse meist in größeren Gruppen auf. Die Grupppe aus Nikolaus, Krampus und anderen Begleitern wird als Pass bezeichnet.
Der Name leitet sich von mittelhochdeutsch Krampen (Kralle) oder bairisch Krampn (etwas Lebloses, Vertrocknetes, Verblühtes oder Verdorrtes). In vielen Regionen vermischt sich die Gestalt des Krampus mit dem Perchtenbrauchtum (diverse Schiachperchten).
Im bayerischen Alpenvorland und im österreichischen Salzkammergut ist der Krampus eher unter der Bezeichnung Kramperl geläufig. Im Salzkammergut kommt auch die vom Namen Nikolaus abgeleitete Bezeichnung Niklo vor. Im Tiroler Raum spricht man häufiger von Tuifl, Tuifltog oder Tuifltratzen.
Der Krampusbrauch war ursprünglich im ganzen Habsburgerreich und angrenzenden Gebieten verbreitet, und wurde dann in der Zeit der Inquisition verboten, da es bei Todesstrafe niemandem erlaubt war, sich als teuflische Gestalt zu verkleiden. Jedoch wurde dieser Winterbrauch in manchen schwer zugänglichen Orten weitergeführt.
Ausgehend von den Klosterschulen (Kinderbischofsfest) entwickelte sich seit Mitte des 17. Jahrhunderts der Einkehrbrauch: begleitet von Schreckgestalten, Teufeln und Tiermasken (Habergeiß), prüft und beschenkt der Heilige Nikolaus die Kinder, während die Unartigen vom Krampus bestraft werden. In der Gegenreformationszeit entstanden Stubenspiele, die bis heute in Bad Mitterndorf, Tauplitz und Pichl-Kainisch (Salzkammergut), im Salzburgerland und in Tirol existieren.
Außerhalb der Gegenreformationsgebiete blieben die Krampusse vom norddeutsch-protestantisch geprägten Knecht Ruprecht verdrängt, im alemannisch-protestantischen Raum mischen sich die beiden Formen.
Rauhnächte
Die Rauhnächte (auch Raunächte oder Rauchnächte), zwölf Nächte (auch Zwölfte), Glöckelnächte, Innernächte oder Unternächte sind einige Nächte um den Jahreswechsel, denen im europäischen Brauchtum oft besondere Bedeutung zugemessen wird.
Meist handelt es sich um die zwölf Weihnachtstage, zwischen Weihnachten (25. Dezember) und Erscheinung des Herrn (6. Januar), aber auch andere Zeiträume, beispielsweise zwischen dem Thomastag und Neujahr, kommen in Frage.
Je nach Region unterscheidet sich die Anzahl der Rauhnächte zwischen drei und zwölf Nächten. Als die vier wichtigsten Rauhnächte werden bezeichnet:
- 21./22. Dezember (Thomasnacht, die Wintersonnenwende) (längste Nacht des Jahres)
- 24./25. Dezember (Heiliger Abend, Christnacht, Vigil von Weihnachten)
- 31. Dezember/1. Januar (Silvester)
- 5./6. Januar (Vigil von Epiphanie, Erscheinung des Herrn)
In manchen Gebieten wird die Thomasnacht nicht hinzugezählt.
Die vier wichtigen Rauhnächte galten mancherorts als derart gefährlich, dass sie mit Fasten und Beten begangen wurden. Im Haus durfte keine Unordnung herrschen, keine weiße Wäsche auf der Leine hängen (welche die Reiter stehlen würden, um sie dann im Laufe des Jahres als Leichentuch für den Besitzer zu benützen). Es durften keine Wäscheleinen gespannt werden, da sich in diesen die wilde Jagd verfangen könnte.
In einer anderen Version ist dies besonders (jüngeren) Frauen verboten. Durch das Aufhängen von weißer (Unter-)Wäsche würde die wilde Jagd angelockt und dann über diese Frauen "herfallen". Frauen und Kinder sollten nach Einbruch der Dunkelheit auch nicht mehr alleine auf der Straße sein. In manchen Gegenden des Ostalpenraums wurden diese Vorschriften von Perchten überwacht
St. Barbaratag
Am 4. 12. ist der Namenstag der heiligen Barbara.
Sie zählt zu den 14 Nothelfern und ist die Schutzpatronin für eine gute Sterbestunde, Feuerwehrleute, Glocken und auch das Wetter.
An diesem Tag schneidet man Zweige von Birke, Haselnuss, Kirsche oder Kastanie ab um diese in eine Vase mit Wasser zu stellen.
An einen warmen Platz gestellt sollen die Zweige dann am 24.12. in voller Blüte stehen. Wenn dem so ist, dann soll im nächsten Jahr der Familie eine Hochzeit ins Haus stehen.
Christbaumtauchen in Zell am See
Das Christbaumtauchen in Zell am See ist eine Veranstaltung der Wasserrettung Zell am See, die alljährlich am ersten Weihnachtstag (25. Dezember) am Zeller See (Pinzgau) stattfindet.
Ein zuvor in 15 m Tiefe in der Oberschneidbucht nahe des Grand Hotels Zell am See versenkter Christbaum wird unter den Klängen feierlicher Musik von Tauchern an die Oberfläche gebracht.
Um die Auftauchstelle bilden Taucher einen Kreis mit Fackeln, bevor der Christbaum an das etwa 20 Meter entfernte Ufer gebracht wird.
Ein Feuerwehr und Geschenke eines Weihnachtsmannes an die kleinen Gäste beschließen das Christbaumtauchen in Zell am See.
Aperschnalzen
Das Aperschnalzen (süddeutsch: aper = schneefrei) bezeichnet einen bayerisch-salzburgischen Brauch des Goaßlschnalzens. Es ist ein rhythmisches Schnalzen und Knallen mit einer bis zu 4 Meter langen, kurzstieligen Peitsche (der Goaßl) in kleinen Gruppen, der Passe zu je 9 Personen oder auch 7 Personen.
Aperschnalzen ist ein alpenländisches Brauchtum, das im Bundesland Salzburg sehr lebendig gepflegt wird. Mit dem "Aperschnalzen" sollten einst die guten Geister, der Frühling und vor allem die Sonne wieder geweckt und Finsternis und Winter vertrieben werden. Bezeichnend lautet ein alter Spruch: "Viel Schnalzen bringt ein gutes Jahr".
Die Wurzeln des Aperschnalzens sind unklar. Von der Volkskunde wird das Aperschnalzen jedenfalls dem "Lärmbrauchtum" zugeordnet. Seine ursprüngliche Bedeutung sei die Vertreibung des Winters sowie das Wecken des Frühlings gewesen. Das Wort aper komme vom althochdeutschen Wort "apir", das heißt vom Schnee befreit.
Früher wurde es auch häufig als "Faschingsschnalzen" bezeichnet, weil an es nur in der Zeit vom Dreikönigstag bis zum Faschingsdienstag ausübte.
Die älteste schriftliche Erwähnung des "Apachschnalzens" geht auf das Jahr 1796 zurück. Allerdings wird hier von einem Schnalzen "der Hirten" im Lungau berichtet, das "den ganzen Sommer durch auf den Alpen" dauerte und im Spätherbst mit dem Almabtrieb endete. Also zeitlich genau das Gegenteil vom Aperschnalzen im bayrischen Rupertiwinkl sowie im angrenzenden Salzburg, das im Winter ausgeübt wird und auf die Zeit vom Stefanitag bis Faschingsdienstag begrenzt ist. Umso "dramatischer" wird uns das Aperschnalzen der Hirten auf den Almen geschildert: Es sei "mit der äußersten Anstrengung der Leibeskräfte" verbunden gewesen, wobei die Ausübenden "nicht selten darunter Schaden" gelitten hätten.